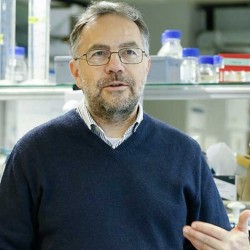So kann der «Müll» der Zellen Krankheiten auslösen

In der Zeitschrift Nature Communications die Ergebnisse einer bedeutenden Studie des Teams von Maurizio Molinari (IRB). Entdeckung der Mechanismen, welche die Entsorgung der defekten Proteine blockieren, die der Ursprung verschiedener Krankheiten sein könnenvon Elisa Buson
Auch bei den Zellen in unserem Körper kann es vorkommen, dass sie sich einer wahren «Müllkrise» ausgesetzt sehen. Wie kleine Müllsäcke stapeln sich haufenweise defekte Proteine, die aufgrund von genetischen Krankheiten oder altersbedingt in ungewöhnlich grossen Mengen vorkommen. Reicht das übliche Entsorgungssystem nicht mehr aus und das Chaos droht, Oberhand zu gewinnen, dann schrillt der Alarm. Einige Zellen, die nicht in der Lage sind, die Situation zu managen, sterben schliesslich ab und schädigen das Gewebe, in dem sie sich befinden. Andere hingegen wenden eine aussergewöhnliche Strategie an, um die Notlage zu überwinden: Enthüllt wurde diese in einer ihrer entscheidendsten Phasen durch eine Studie des Teams von Maurizio Molinari am Forschungsinstitut für Biomedizin (IRB) in Bellinzona. Die in der renommierten Zeitschrift Nature Communications veröffentlichten Ergebnisse könnten sich für die Diagnose und Therapie zahlreicher seltener Krankheiten als wertvoll erweisen, möglicherweise auch für die neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer, die das Gehirn befallen.
«In den kranken Zellen – berichtet Molinari (der am IRB das Kontrolllabor der Proteinsynthese leitet) – geschieht genau das, was wir auch in unseren Städten beobachten: Die defekten Proteine häufen sich als Müll an, entweder, weil sie wie bei Kindern mit Stoffwechselstörungen im Überschuss produziert werden, oder weil das Entsorgungssystem wie bei älteren Patienten nicht mehr effizient arbeitet.» Um zu verstehen, was in solchen Fällen geschieht, haben die Forscher die Notlage in Säugetierzellen, die im Reagenzglas gezüchtet wurden, nachgebildet. Diese Zellen wurden mit einer gentechnischen Grenztechnik namens CRISPR, welche die DNA «kopiert und wiedereinfügt», um sie höchstpräzise zu transkribieren, verändert. «Wir haben Mutationen eingeführt, um die Zellen zur übermässigen Bildung defekter Proteine anzuregen – erklärt Molinari – und bei Erreichen eines kritischen Levels haben wir diese Bildung eingestellt, um zu sehen, welche Mechanismen die Zellen anwenden, um sich zu verteidigen und von dem Stress zu erholen.» Wie richtige Ermittler haben die Forscher die Zellen engmaschig observiert und detaillierte, dreidimensionale Bilder gesammelt, die mit der Kernspinresonanz, dem Konfokalmikroskop und dem Elektronenmikroskop in Kooperation mit dem DiBiT, dem Departement für Biologie und Technologie des Krankenhauses San Raffaele in Mailand, erzielt wurden.
«Auf diese Weise – so Molinari weiter – haben wir herausgefunden, dass die Zelle den Müll in ein Speziallager im Inneren des „Protein-Kraftwerks“, des endoplasmatischen Retikulums, bringt. Man kann sich das in etwa wie eine Fabrik vorstellen, die Fahrräder herstellt und die defekten beiseite anhäuft, um den Ablauf der Montagekette nicht zu behindern: Ist der Container voll, wird er in die Müllverbrennungsanlage (das Lysosom) befördert und zerstört.» Der im Normalzustand immer aktive Mechanismus kann im Notfall noch weiter verstärkt werden. Um die Krise zu bewältigen, kann die Zelle zusätzliche «Müllmänner» (die sogenannten Abbaufaktoren) einstellen und sogar einige «Arbeiter» (die Chaperon-Proteine) von der Produktionslinie zur Entsorgungsstelle entsenden, wie es bei dem Protein SEC62 der Fall ist, das fast drei Jahre lang von Molinaris Team beobachtet wurde.
«Diese Grundlagenforschung dient nicht nur der Befriedigung unserer Neugier über die Funktionsmechanismen der Zellen», betont der Biologe, der seit über 20 Jahren am IRB an Zellmodellen arbeitet, die seltene, vor allem typische Kinderkrankheiten nachbilden. «Sollte es uns gelingen, alle Mechanismen nachzubilden, die den Abbau des Zellmülls steuern – fügt er hinzu –, dann könnten wir wahrscheinlich verstehen, weshalb zwei Kinder, die denselben Genmutation haben, einen vollkommen unterschiedlichen Krankheitsverlauf aufweisen können. Nehmen wir beispielsweise Kinder mit „Alpha-1-Antitrypsin-Mangel“: Einige häufen das Protein in seiner mutierten und nicht funktionierenden Form in der Leber an, sodass innerhalb von zwei Jahren eine Transplantation erforderlich wird, andere Kinder hingegen können es abbauen und überleben bis zum Erwachsenenalter. Wir vermuten, dass Erstere wegen bisher noch unbekannter Genmutationen eine weniger effiziente zelluläre „Verbrennungsanlage“ haben. Falls es uns gelingt, sie zu entdecken, könnten wir diese Kinder einem Gentest unterziehen, mit dem man den Krankheitsverlauf vorhersehen und somit die Therapie von Anfang an ganz gezielt darauf abstimmen könnte.»
Das wäre für die Bekämpfung seltener Krankheiten, «von denen geschätzt rund 12% der Schweizer Bevölkerung betroffen sind», ein bedeutender Schritt vorwärts sein, betont Molinari. «Genau hier im Tessin haben wir eine Plattform geschaffen, die bei der Implementierung des Nationalen Konzepts für seltene Krankheiten in der Italienischen Schweiz helfen soll und die ein Bezugspunkt für Ärzte und vor allem die Familien der kranken Kinder wird, die sich mit den wichtigen Fragen rund um die Behandlung und die Behandlungskosten häufig alleine konfrontiert sehen.»
Das IRB ist auch Mitglied von AcceleRare, dem Schweizer Konsortium für seltene Krankheiten, dem 28 Partner von 12 Instituten angehören, die von der Universität Genf, der Universität Zürich sowie der Technischen Hochschule Zürich koordiniert werden. Molinaris Gruppe leistet ihren Beitrag mit einem jungen und dynamischen Team, dem vor allen Doktoranden angehören. «Sie bringen die Projekte voran, mit Unterstützung unserer „Mamas“: Vier Frauen, die sich nach dem Studium oder dem Doktorat gegen eine Karriere in der Forschung, sondern für eine Teilzeit-Mitarbeit entschlossen haben, um Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen», erzählt Molinari. Zwischen den Elternzeiten sind diese Frauen super aktiv «und bilden das Fundament des Labors, dessen historisches Vermächtnis sie verwahren: Sie kennen alle Techniken und Materialien, die wir verwenden, sie stellen die Reagenzien her und helfen den Doktoranden bei der Durchführung der Experimente. Ohne sie wäre unsere Arbeit unmöglich.» Dass es sich hierbei um ein erfolgreiches Organisationsmodell handelt, zeigt sich am Prestige der Zeitschriften, in denen die Arbeiten der Gruppe veröffentlicht werden, aber nicht nur. «Seit 2000 haben wir fast mehr Kinder hervorgebracht als wissenschaftliche Publikationen!», meint Molinari abschliessend.